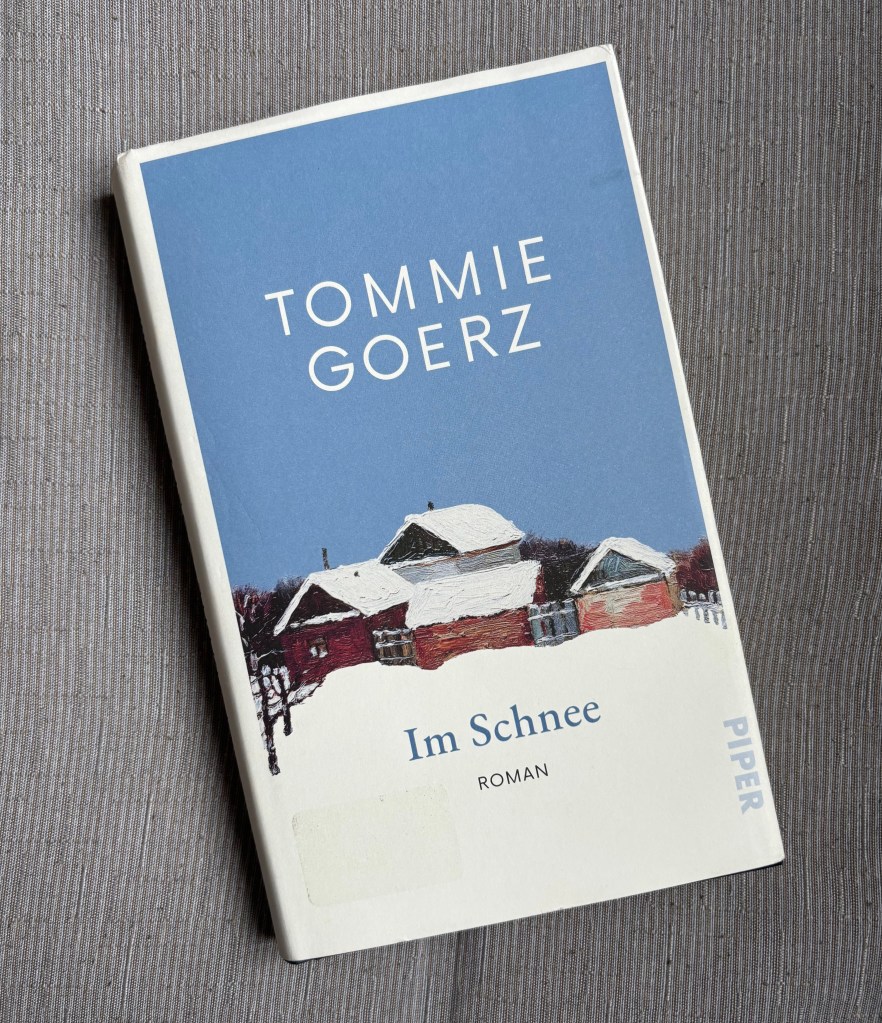Ich möchte mich vorab bei Euch entschuldigen, dass dieser Beitrag nicht in den gewohnt kurzen Häppchen daherkommt, die ich sonst anzustreben suche. Denn meine eigene Aufmerksamkeitsspanne erschöpft sich online schnell durch allzu lange Texte. Aber diesmal muss ich etwas ausholen.
Manch eine(r) erinnert sich an die Kolumne „Mehr als 40“, aus der längst bei vielen von uns ein “Mehr als 50“ geworden ist und das zugegebenermaßen mit einigem Struggle. Ich selbst steuere gerade die Zielgerade zur 51 an. Zeit also zu hinterfragen, was sich in diesen letzten Jahren verändert hat.
Da wäre festzustellen, dass mein so genannter Kulturbeutel deutlich an Umfang gewonnen hat. Neben diversen Cremes mit und ohne Lichtschutzfaktor, tummeln sich Pillen, Tropfen und Salben, manche unbedingt notwendig, andere für den Fall der Fälle in Zeiten einer gewissen Anfälligkeit für Eindringlinge jeglicher Art. Seit letztem Winter hat der Schal einen neuen Stellenwert in meinem Leben bekommen, gebar sich mein Hals auf einmal auch bei milderen Temperarturen und Fahrtwind sensibel. Wie ich das modisch lösen werde, weiß ich noch nicht, wollte ich doch niemals der Gattung der chronischen Halstuchträgerinnen zugerechnet werden. Meine Zähne werden schäbiger und dunkler und stehen damit im krassen Gegensatz zu all den gebleachten, perfekten Zahnreihen, die mich mehr und mehr umgeben. Zugegebenermaßen mutet es manchmal schon grotesk an, wenn ich bei meinem Gegenüber ausschließlich Zähne wahrnehme, weil sie so hell strahlen, aber ein wenig von ihrem Glanz würde ich gerne abbekommen. Das Smartphone hat sich unauffällig einen Rang in der Pole Position meines Lebens erobert, allem Gegensteuern zum Trotz. Bahnfahren, Wandern, Verabreden, Bezahlen, es hat sich auch an Detoxtagen unentbehrlich gemacht und so bemerke ich, wie ich viele dutzend Mal am Tag das Handy in die Hand nehme und prüfe, ob etwas in meinem Leben passiert sein könnte. Es liegt inzwischen zuhause am Esstisch ebenso wie am Tisch im Café mit Freundinnen, weil es immer etwas zu zeigen oder nachzusehen gibt. Dass wir Menschen uns so leicht unserer Freiheit haben berauben lassen, gefällt mir überhaupt nicht.
Und damit komme ich zu dem Punkt, der diesen Text etwas umfangreicher macht. Die Veränderungen im Außen schmecken mir weitaus weniger als die Zipperlein und Neurosen, die ich vielleicht in den letzten Jahren entwickelt habe. Letzthin musste ich beispielsweise mit Schrecken feststellen, dass man in einem bekannten schwedischen Möbelhaus, sowie bei einer französischen Sportartikelkette nur noch an Self-Service Kassen bezahlen kann. Bei neu eröffneten Supermärkten ist es sowieso schon gang und gäbe, dass auf Kassierer(innen) aus Fleisch und Blut verzichtet wird. Totschlagargument ist stets der Personalmangel. Aber wie diskriminierend ist das bitte? Ob für alte Menschen, Menschen mit Behinderung, einsame, überforderte oder altmodische wie mich. Das Gegenteil von Inklusion und einfach schrecklich. Schön, dass zumindest wenige Supermärkte, extra so genannte „Plauderkassen“ eingerichtet haben, damit das Zwischenmenschliche nicht vollkommen verloren geht. Ein kurzer Schnack, ein freundliches Lächeln und schon sieht der Tag anders aus. Ich mag das. Zugegebenermaßen erlebe ich leider in jüngster Zeit vermehrt Begegnungen der anderen Art, gereizt und konfrontativ, weil die Menschen am Anschlag zu sein scheinen. Manche Restaurants weisen sogar mit Schildern darauf hin, man möge dem Personal freundlich begegnen, weil man vielleicht sonst noch die wenigen Menschen vergrault, die den Job überhaupt noch machen wollen. Was läuft da falsch?
Ich denke, wir Menschen sind überfordert von dem Tempo und der Komplexität dieser Zeit. Es tut uns nicht gut, von Informationen und Schreckensmeldungen überflutet zu werden, aber auch von Werbung, die uns suggeriert, wie wir sein sollen, was wir tun müssen und welchem Ideal wir zu entsprechen haben. Ich unterstelle den Big Playern, dass es sich um reines Kalkül handelt, die Menschen dazu zu bringen, sich um Shopping, Beautyroutinen und Nahrungsergänzungsmittel zu drehen, damit sich unser Hirn nicht mit Wichtigem beschäftigen kann. Mit dem, was wir wollen, was uns guttut und was auf dieser Welt verdammt schiefläuft. Sonst würden wir vielleicht endlich dafür sorgen, dass Social Media nicht mehr von wirtschaftlichen Interessen gesteuert wird, sondern im Sinne einer Weltgemeinschaft. Das würde so viel verändern!
Auch bei mir hat sich eine große Müdigkeit eingeschlichen, mich mit Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Dabei ist es wichtiger denn je, sich nicht taten- und willenlos von diesem Strudel mitreißen zu lassen, sondern sich gegen diese Entwicklungen zu wehren. Ich finde sie jedenfalls weitaus schlimmer als all meine Falten und Beulen, die in den letzten zehn Jahren dazugekommen sind. Bei einer Freundin ist mir das Buch „Du sollst nicht funktionieren“ von Ariadne von Schirach in die Hände gefallen, erstaunlicherweise schon 2014 erstmals veröffentlicht. Ich habe mich sehr wiedergefunden mit vielen Themen unserer Zeit, wie beispielsweise dem Appell, sich zu empören. Nicht abzustumpfen und zu resignieren. Aber auch damit, wie die Autorin schildert, was die Entwicklung mit Fokus im Außen mit jedem einzelnen und somit auch mit unserer Gesellschaft macht.
Ich könnte vom Hundertsten ins Tausendste kommen und verbleibe an dieser Stelle doch mit meinem Vorsatz, mit mehr Bewusstsein und weniger Schicksalsergebenheit durchs Leben zu gehen. Und mal sehen, wie dann eines Tages das Resümee zu „Mehr als 60“ ausfallen wird, so mir diese Zeit gegeben werden mag und ich diesen Blog noch fortführe.
Seid herzlich gegrüßt,
Eure Ella