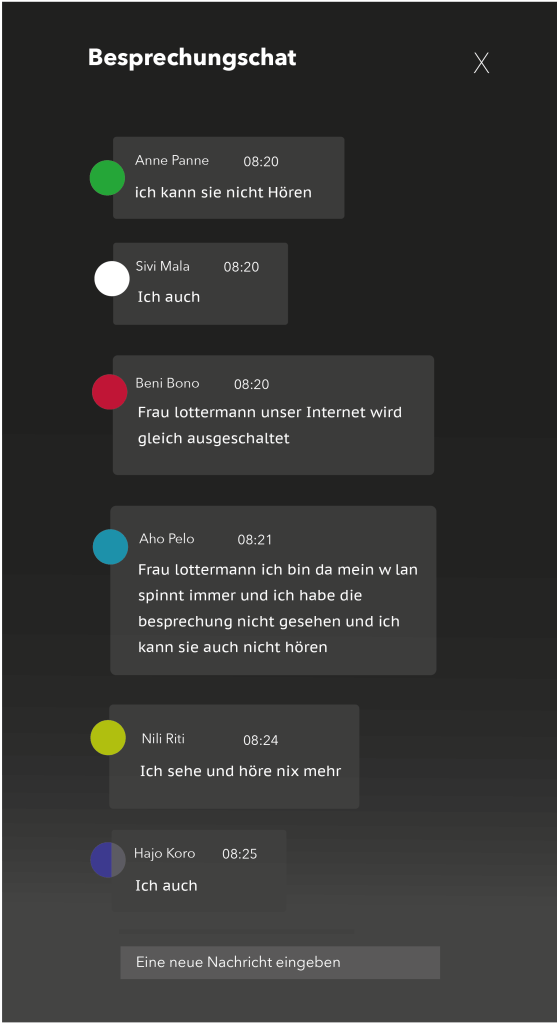Auch, wenn es mir nicht so recht passt, muss ich zugeben, dass YouTube und andere Social-Media-Kanäle nicht ausschließlich schlechte Seiten haben. So kannte mein Sohn bereits eine Vielzahl von Fischen, deren Lebensräume und geeignete Köder, um sie zu fangen, bevor er überhaupt zum ersten Mal eine Angel in der Hand hielt. Der Angelschein war sozusagen nur noch Formsache. BROSEF, dem YouTube Angelgott, sei Dank!
Und es wäre eine glatte Lüge, zu behaupten, die regelmäßigen Exkursionen unserer Jungs in unwegsames, bergiges Gelände, hätten mit den gemeinsamen Familienwanderungen ihrer Kindheit zu tun. Naja, vielleicht am Rande. Der wahre Grund dafür liegt darin, dass sie tagtäglich online angefixt werden. Da rennen junge Burschen mal schnell einen Zweitausender hoch, laufen wochenlang Ultramarathons durch ferne Länder oder durchqueren mal eben einen riesigen See. Abenteuer pur, Superlativen am laufenden Meter. Was früher vielleicht nur eingefleischte Fans in Fachzeitschriften erfahren haben, erscheint heute pillepalle und für jede(n) machbar.
Und genau darin liegt das Problem. Die sowieso schon hohe Risikobereitschaft von Jugendlichen wird befeuert, indem alles möglich scheint – und zwar sofort. Die Gefahren von Verletzungen und Spätfolgen, die durch mangelnde Vorbereitung und Selbstüberschätzung entstehen können, werden in Formaten, deren Fokus auf Unterhaltung und Spaß liegt, kaum thematisiert. Spaßbremsen haben vermutlich nicht ganz so viele Follower. Und welcher Teenager möchte sich schon damit auseinandersetzen, dass er als „alter Sack“ (O-Ton mein Kind für alle über ca. 35 Jahre) vielleicht einmal neue Kniegelenke brauchen könnte, wenn er es jetzt körperlich übertreibt? Der Präfrontale Cortex, der für Vernunft und Weitsicht zuständig ist, ist in diesem Stadium des Lebens bekanntlich noch recht spärlich ausgebildet.
Es wäre aber auch falsch zu behaupten, dass sich die Jugendlichen ihren Vorhaben völlig blauäugig annähern. Sie sind nämlich gleichzeitig oft wahre Fitness-Pros. Wo wir früher unseren Puls mit dem Zeigefinger an der Halsschlagader zu spüren suchten, und dabei gebannt dem Sekundenzeiger der großen Sporthallenuhr folgten, sind unsere Kinder heute perfekt getrackt. Apps und Fitnessuhren messen den Puls, den so entscheidenden „Pace“ (die Durchschnittsgeschwindigkeit), sie zeichnen die gelaufenen Strecken und die Bestzeiten auf, um zu motivieren, sie mit der Community zu teilen und dadurch wiederum angespornt zu werden. Man kann sich Trainingspläne zusammenstellen lassen und deren Einhaltung einfordern. Die jungen Sportler*innen verfügen oft über ein breites Wissen rundum Trainingsmethoden und Fitness. Ob dieses Wissen fundiert ist, hängt vor allem davon ab, welche Inhalte ihnen der Algorithmus zuführt oder wem sie folgen. Die Feeds auf TikTok sind bei ihnen oft gespickt mit Videos rundum das Thema Ernährung. Das führt leider dazu, dass bereits Teenager zu Proteinpulvern, Kreatin und anderen Nahrungsergänzungsmitteln greifen, um ihre sportlichen (oder optischen) Ziele schnellstmöglich zu erreichen. Andererseits leben viele Jugendliche durch ihr Wissen auch sehr gesundheitsbewusst. Manche verzichten sogar auf Zucker und Alkohol, weil der Konsum ihrem Körper schaden könnte.
Ich sehe dem Ganzen mit einer Mischung aus Freude und Bangen zu. Freude, weil meine Kinder ihre Zeit nicht nur am Handy oder PC verbringen, sondern auch in der analogen Welt, in der Natur, mit Freunden. Sie erleben den Sonnenaufgang auf einem Gipfel, sie erfahren, dass im April auf dem Berg noch Schnee liegen kann, auch wenn die Webcam etwas anderes anzeigt, sie lernen, was man für Ausrüstung in der Natur wirklich benötigt, und dass das richtige Schuhwerk durchaus von Vorteil ist. Sie sammeln einen Schatz an wertvollen und beeindruckenden Erfahrungen, der sie durch ihr Leben begleiten wird. Und dennoch steht auf der anderen Seite das Bangen, weil ich darauf vertrauen muss, dass sie Gefahren richtig einschätzen, dass sie bei einem Wetterumschwung auch wirklich umkehren, dass sie den Weg nicht gehen, wenn er zu steil und abschüssig ist. Ich erinnere mich dann manchmal an meine Jugend, wo die Gefahren an ganz anderer Stelle zu umklippen waren. Im Nachtleben, bei der Neugier auf Drogen, im Rausch. Das lässt mich dann wieder meine Bedenken und Ängste relativieren.
Die Jugend ist eine gefährliche Zeit, eine Zeit des Ausprobierens und Wagens. Ich versuche, Ihnen meine Ängste nicht überzustülpen und dennoch auch Nein zu sagen, wenn es erforderlich scheint. Das ist die größte Herausforderung für mich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Vielleicht sollte man diesen Vermerk und ein paar zusätzliche Fußnoten auch dem ein oder anderen YouTube Video hinzufügen.